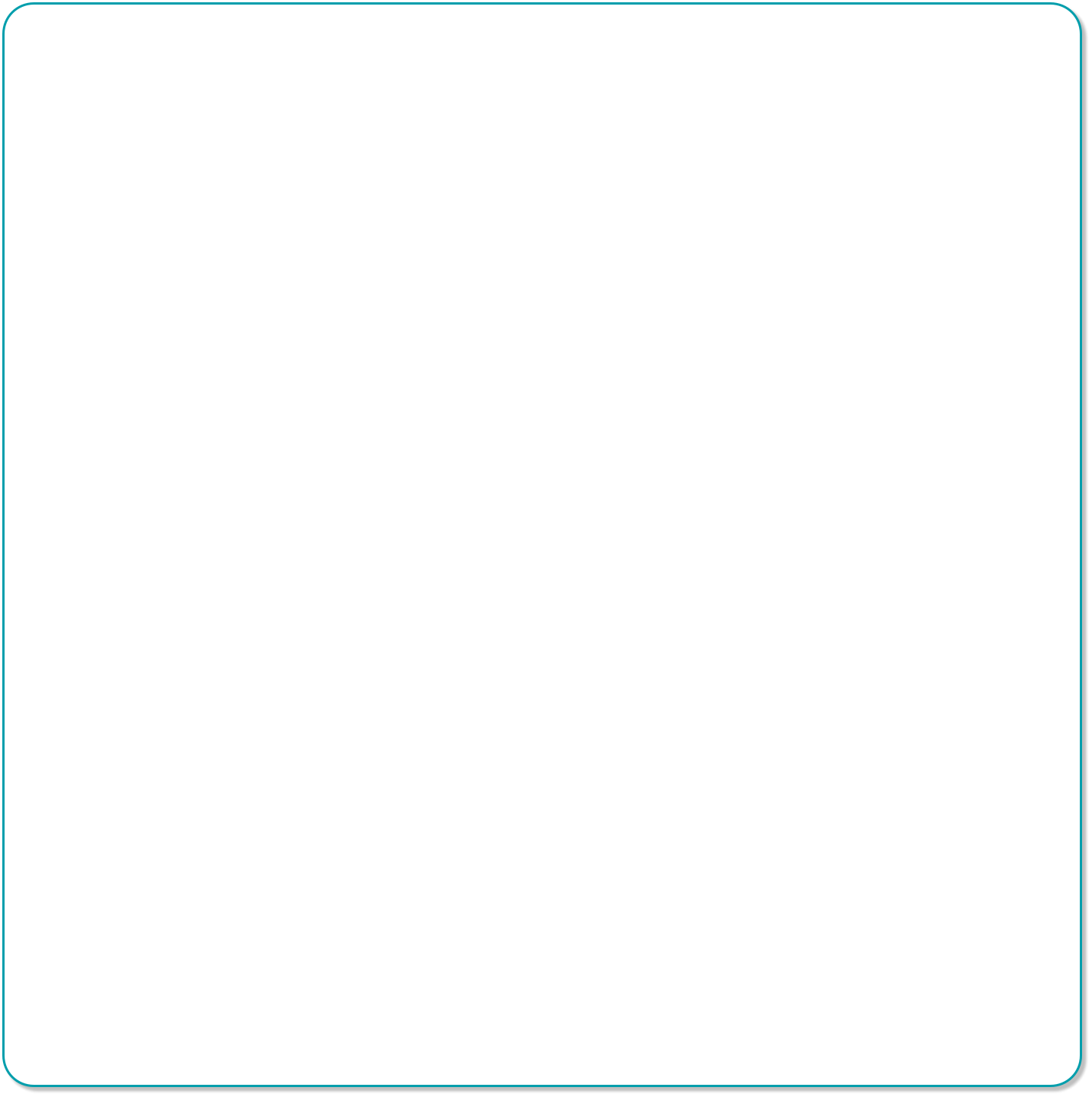


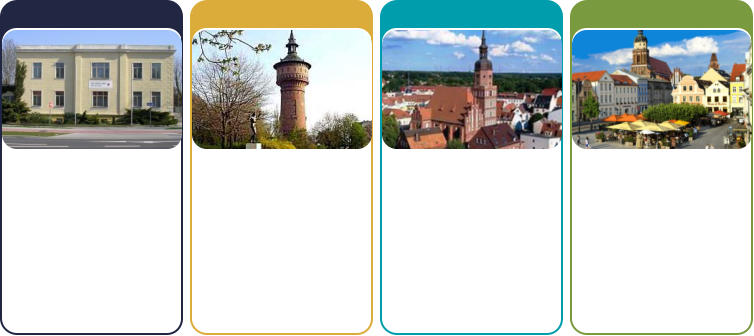
Döbern
Forst / Lausitz
Zu den größeren
Städten und
Gemeinden im
Umland von
Tschernitz gehören
Forst (Lausitz) 16 km
nördlich,
Spremberg
Cottbus
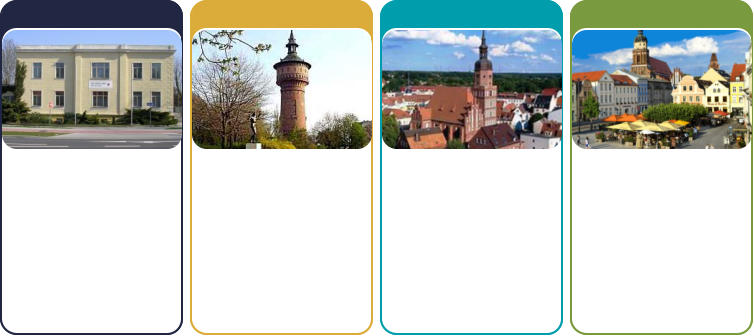
Döbern
Forst / Lausitz
Zu den größeren
Städten und
Gemeinden im
Umland von
Tschernitz gehören
Forst (Lausitz) 16 km
nördlich,
Spremberg
Cottbus
©Webgestalter & Studio VideoWeb Tschernitz
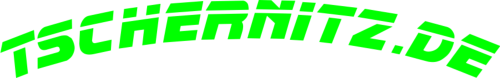





Ticker


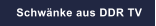





2026
Mediathek in deinem Heimatsender
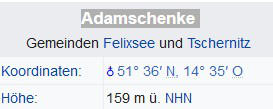



Euromillions: 113,5 Millionen Franken: Belgier knackt Jackpot

Am Freitag wurde der Jackpot von Euromillions geknackt. Der Preis im Wert von 113,5 Millionen Franken geht an
eine glückliche Person in Belgien.
Darum gehts
•
Eine Person hat den Euromillions Jackpot geknackt.
•
Sie gewinnt 113,5 Millionen Franken.
•
Der Gewinner kommt aus Belgien.
Am Freitag hat ein glücklicher Mensch die Euromillions geknackt. 113, 5 Millionen Franken gehen an
die
Gewinnkombination 14, 18, 31, 35 und 46, mit den Sternen 7 und 11. Dies berichtet der «Blick» mit
Bezug auf die
Nachrichtenagentur SDA.
Die oder der Glückliche kommt laut Swisslos aus Belgien. Es ist eines von zwölf Ländern, in denen um die Euromillions gespielt werden
kann. Nun startet am Dienstag wieder ein neue Runde mit 16 Millionen Franken im Jackpot.





Pleite in Tschernitz überschattet
grüne Pläne
Strukturwandel Der Start des Net Zero
Valley Lausitz für neue
Schlüsseltechnologien der
Energiewende fällt mit der Insolvenz
der letzten Solarglasfabrik Europas
zusammen. Das nagt am Ruf der
Sonderwirtschaftszone.

Österreich: Asbest auf McDonald's-Spielplatz: «Nur Spitze des Eisbergs»
Greenpeace hat bei Untersuchungen an diversen Orten im Burgenland eine
erhebliche Asbestbelastung festgestellt. Während Firmen bereits reagieren, fordert
auch die Politik schnelle Massnahmen.
Darum gehts
•
Im Burgenland deckte Greenpeace eine hohe Asbest-Belastung auf.
•
Betroffen sind Spielplätze und Raststätten, aber auch Strassen in
Wohnquartieren.
•
Politik und Umweltschützer fordern nun flächendeckende Kontrollen.
In Österreich sorgt ein Asbest-Skandal für viel mediale Beachtung: In eigens
durchgeführten Untersuchungen hat Greenpeace an diversen Orten im Burgenland
an der Grenze zu Ungarn teils massive
Asbestbelastungen festgestellt. Wie die
Organisation in einer ersten Mitteilung
am 23. Januar schrieb, habe man an neun
Stellen in Oberwart, Rechnitz und
Neumarkt im Tauchental
Materialproben entnommen und im
Labor
analysieren lassen.

Genesis: Zurück zum Verbrenner und zum normalen
Garagen-Verkauf
Darum gehts
•
Genesis-Europachef Peter Kronschnabl ändert die
Strategie der Marke.
•
Die Automarke kehrt in Europa zu
Hybridfahrzeugen zurück.
•
Genesis setzt neu auf ein klassisches Händlernetz
statt Direktvertrieb.
•
Der neue GV60 Magma soll Genesis sichtbarer
machen.
Peter Kronschnabl übernahm vor fünf Monaten die
Leitung von Genesis in Europa. Ein Gespräch über die
überraschende Rückkehr des Hybrids, den Abschied
vom reinen Direktvertrieb und warum der Datenschutz
bei der koreanischen Marke ein stiller, aber wichtiger
Trumpf ist.
Herr
Kronschnabl, die
Automobilwelt
ist derzeit von
grosser
Ungewissheit
geprägt. Vor zwei
Jahren hiess es
bei Genesis
noch: in Europa
nur elektrisch.
Wie gehen Sie
heute mit dieser
Strategie um?

Peter Kronschnabl: Ich bin ein
Freund von Technologieoffenheit.
Die Entscheidung für reine
Elektromobilität wurde vor zwei
Jahren getroffen, als viele
dachten, das Thema würde
schneller kommen. Wir haben
diese Entscheidung jetzt
überarbeitet.
Global gibt es bei Genesis vom
Hybrid über den Verbrenner bis
zum Elektroauto ein komplettes
Portfolio.
Wir werden deshalb in Europa und in der Schweiz ab Ende 2027 wieder mit Hybriden
antreten und dementsprechend die Offenheit für unterschiedliche Antriebsstränge
anbieten.













